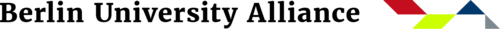„Wenn Frauen Forschungsteams leiten, publizieren diese Teams häufiger zum Thema Geschlechterunterschiede“
Prof. Dr. Gertraud (Turu) Stadler ist Professorin für geschlechtersensible Präventionsforschung an der Charité – Universitätsmedizin und leitet dort die Arbeitseinheit Geschlechterforschung in der Medizin. Im Interview spricht sie über ihre Arbeit als Forscherin und über ihre Ziele in den Feldern Gleichberechtigung, Teilhabe und Chancengleichheit.
Frau Stadler, was verbirgt sich hinter Ihrem Forschungsgebiet „geschlechtersensible Präventionsforschung“?
Die Präventionsforschung ist mein Kernthema, in dem ich untersuche, wie wir möglichst gesund bleiben und chronische Krankheiten vermeiden können. Je früher im Leben wir damit beginnen, gesunde Verhaltensweisen und Umgebungen zu fördern, desto mehr gesunde Lebensjahre gewinnen wir. Mit unserem Forschungsteam sind wir beispielsweise in über 30 Berliner Schulen aktiv und machen geschlechtersensible Rauchprävention mit den Schülerinnen und Schülern. Die Kinder gewinnen bis zu zehn gesunde Lebensjahre, wenn sie rauchfrei bleiben, und unser Programm soll dabei helfen. Jungen, Mädchen und nichtbinäre Kinder sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Und dafür braucht es personalisierte Maßnahmen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Warum sind solche personalisierten Ansätze wichtig?
Beim Gesundheitsverhalten beobachten wir große Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Jungen und Männer finden es teilweise unmännlich, einen Salat oder Gemüse zu essen. Toxische Männlichkeitsbilder wie der coole „Marlboro-Man“ sind noch stark in den Köpfen verankert. Frauen werden viel häufiger mit Depressionen und Angst diagnostiziert, Männer begehen aber dreimal so häufig Suizid. Sie sind auch häufiger übergewichtig und nehmen Vorsorgeuntersuchungen seltener wahr. Männer sterben durchschnittlich fünf Jahre früher als Frauen – und zwar nicht, weil es Schicksal ist, sondern weil es Geschlechterunterschiede im Gesundheitsverhalten und den Lebensbedingungen gibt. Umgekehrt haben Frauen gesundheitliche Nachteile, wenn es etwa um die Behandlung eines Herzinfarkts geht. Die Diagnose und Versorgung sind hier auf den männlichen älteren Durchschnittspatienten ausgerichtet. Frau haben andere Symptome und einen anderen Verlauf. So etwas müssen wir in der medizinischen Forschung und Versorgung besser berücksichtigen.
Wie finden Ihre Ergebnisse den Weg in die medizinische Praxis, um eine geschlechter- und diversitätssensible Versorgung zu etablieren?
Die Forschung dazu steckt in Deutschland und Europa noch in den Kinderschuhen. Es ist eine Querschnittsaufgabe, die nicht nur von einzelnen spezialisierten Einrichtungen und Initiativen erledigt werden kann. Wir brauchen die Beiträge von allen, die zu Gesundheit forschen. Am besten gelingt das, wenn wir Geschlecht und Diversität in allen Studien systematisch berücksichtigen. In Kanada beispielsweise ist das schon Realität. Bei allen öffentlich geförderten Projekten werden die Ergebnisse im Abschlussbericht getrennt nach Geschlechtern aufgeführt. Dann kann man erkennen, wo es Unterschiede gibt – und wo nicht. Wenn wir eine personalisierte Medizin anbieten wollen, brauchen wir bessere Daten. An der Charité untersuchen wir deshalb auch, wie man Diversität eigentlich messen und erfassen kann und entwickeln Methoden, um große Datenmengen gut zu analysieren. Und schließlich arbeiten wir daran, was wir bereits wissen, auch in der Lehre zu verankern. Und zwar über alle Disziplinen hinweg.
Was sollten wir beim Thema Diversität in der Medizin neben dem Geschlecht noch berücksichtigen?
In der Berlin University Alliance haben wir genau zu dieser Frage ganz am Anfang ein gemeinsames Projekt mit über 50 Expert*innen aus dem Berliner und dem internationalen Raum durchgeführt. Der Klassiker ist das Alter, das in der Medizin und Gesundheitsforschung routinemäßig erhoben wird. Aber damit hört es schon auf. Es gibt so viele weitere wichtige Größen: Etwa die soziale Lage, also Bildung, Finanzen, materielle Ressourcen von Personen. Wir wissen, dass die soziale Lage einen sehr großen Einfluss auf Gesundheit hat, aber es gibt kaum systematische Erhebungen. Weiter geht es mit Komorbiditäten – also parallelen psychischen und körperlichen Erkrankungen –, sowie Beeinträchtigungen und Behinderungen, die häufig ebenfalls unzureichend erfasst werden. Sorgearbeit spielt ebenfalls eine Rolle, wenn Frauen zum Beispiel eine Reha nicht aufnehmen, weil sie kleine Kinder oder andere Familienangehörige versorgen wollen. Auch sexuelle Orientierung, Ethnizität, Religion und Weltanschauung sind wichtige Diversitätsdomänen, die bisher wenig berücksichtigt wurden. All das hat Einfluss darauf, wie ich jemanden angemessen medizinisch versorge, ob ein Medikament gut wirkt oder ob wichtige Informationen die Patient*innen erreichen. Am Ende unseres Projekts haben wir einen DiversitätsMinimalItemSatz (DiMIS) erstellt, also einen Vorschlag für einen Minimalfragebogen zu Geschlecht und Diversität, so dass künftige Studien sie systematisch berücksichtigen können.
Sie sind nicht nur Professorin an der Charité, sondern auch Mitglied des wissenschaftlichen Gremiums – des Steering Committees – zum Querschnittsthema Diversität und Geschlechtergleichheit an der BUA. An welchen konkreten Zielen arbeiten Sie in dieser Funktion?
Im Komitee sind Mitglieder aus allen vier BUA-Verbundpartnerinnen. Das sind Forschende aus dem Bereich Diversität und Geschlechterfragen und auch die zentralen Gleichstellungsbeauftragten, die sich sehr gut mit praktischen Maßnahmen auskennen, um Chancengleichheit zu erhöhen. Wir stehen in einem sehr guten produktiven Austausch und bringen im Exzellenzverbund sowohl die Forschung zu diesen Themen als auch die Bedingungen im integrierten Forschungsraum voran, damit alle ihr Talent gut entfalten können. Ein Beispiel dazu: Wenn Frauen Forschungsteams leiten, publizieren diese Teams auch häufiger zum Thema Geschlechterunterschiede. Die Zusammensetzung von Forschungsteams spielt eine Rolle dafür, welche Fragen untersucht werden. Menschen mit Marginalisierungserfahrung haben eine höhere Sensibilität für diese Themen.
Wie weit sind wir in Berlin auf dem Weg zur Chancengleichheit in der Forschung?
In Berlin haben wir seit den 90er Jahren etwa 50 Prozent weibliche Studierende in der Medizin. In der Stadtbevölkerung haben rund 40 Prozent der Menschen eine Migrationsgeschichte. Berlin ist bunt und vielfältig, wir haben sozusagen die ganze Welt bei uns zuhause. Aber die Menschen, die hier vor Ort so wichtige Themen wie „Global Health“ und „Diversity“ direkt verkörpern könnten, sind in den Institutionen noch unterrepräsentiert. Wir wissen aus internationalen Daten, dass wir in der Wissenschaft eine „Leaky Pipeline“ haben, also einen massiven Talentverlust über die Hierarchieebenen hinweg. Talentierte aus unterrepräsentierten Gruppen haben es schwerer, in Führungspositionen zu gelangen.
Welche Talente und welches Potenzial gehen der Wissenschaft damit verloren?
Wir können von den Erfahrungen lernen, die diese Menschen mitbringen. Etwa, wie Gesundheitssysteme in anderen Ländern funktionieren. Ein gutes Beispiel ist Kerala im Süden Indiens. Die Lebenserwartung ist dort ähnlich hoch wie in hochindustrialisierten Ländern, ohne dass dieselben Möglichkeiten der Hochleistungsmedizin zur Verfügung stehen. Unter dem Stichwort „Reverse Innovation“ könnte unser Gesundheitswesen von einigen der dort entwickelten, gut funktionierenden und weniger kapitalintensiven Lösungen profitieren. Auch von Forschenden, die aus Ländern mit hoher Pandemieerfahrung kommen, können wir viel lernen. Die BUA kann wichtige Entwicklungen anstoßen und Impulse geben, um solche Potenziale zu heben. Für die dritte Grand Challenge haben wir beispielsweise eingeführt, dass in den Anträgen für Forschungsgelder ein Denkanstoß enthalten ist zu prüfen, ob Geschlecht und Diversität für die Forschungsfragen eine Rolle spielen. Das wird sonst oft vergessen. Unser Mentoringprogramm für Frauen auf dem Weg zur Professur –ProFil – haben wir um eine englischsprachige Linie erweitert, um eben auch jene zu erreichen und zu fördern, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Exzellente Forschung ist international und wir müssen uns besser dafür rüsten, diese Internationalisierung voranzubringen.