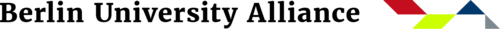Mit Vielfalt blüht exzellente Wissenschaft auf
Diversität und Gleichstellung sind die Grundlage für gerechte, gut funktionierende Gesellschaften – und ebenso für exzellente Forschung. Die Perspektiven und Erfahrungen von Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters, Nationalität oder mit Beeinträchtigungen sind in allen gesellschaftlichen Bereichen ein Gewinn. Wer gute Antworten auf herausfordernde Zukunftsfragen finden möchte, benötigt vielfältige Expertisen und Talente. Ohne Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit verliert die Wissenschaft dagegen wertvolle Kompetenzen. Wie werden die Ziele des Schwerpunktthemas Diversity and Gender Equality im Berliner Forschungsraum umgesetzt? Ein Einblick über Hindernisse, Erfolge, Zukunftspläne und Chancen.
Das Diversity and Gender Equality Network (DiGENet)

Das größte Hindernis ist nicht der Rollstuhl
Die Wissenschaft profitiert von Talenten aus der ganzen Welt, die nicht nur ihre Fachexpertise, sondern auch unterschiedliche Erfahrungen und Lebensgeschichten einbringen. Die europäischen Wissenschaftsinstitutionen bekennen sich ausdrücklich zu Vielfalt und Diversität in der Forschung. Doch für Angehörige von unterrepräsentierten Gruppen ist der Weg in die wissenschaftliche Karriere dennoch häufig besonders schwierig. Die Molekularbiologin und Hirnforscherin Alexandra Tzilivaki musste enorme Hürden überwinden, um in Berlin arbeiten zu können.
Die Freude war groß, als Alexandra Tzilivaki im Jahr 2017 die Zusage für ein Promotionsstipendium beim Einstein Center for Neurosciences Berlin (ECN) – einem der größten neurowissenschaftlichen Netzwerke Deutschlands – erhielt. Die Nachwuchsforscherin aus Griechenland plante sofort ihren Umzug von Heraklion auf Kreta, wo sie ihr Masterstudium in Molekularbiologie und Biomedizin absolviert hatte, nach Berlin. Im Exzellenzcluster NeuroCure wollte sie ihre bereits in Griechenland begonnene Forschung über spezielle Nervenzellen in Säugetierhirnen – sogenannte inhibitorische Interneuronen – und deren Einfluss auf das Lernen und Erinnern fortsetzen und darüber promovieren.
Mit Computermodellen Nervenzellen erforschen
In der wissenschaftlichen Karriere ist so ein Umzug in ein anderes Land, der Abschied vom gewohnten Umfeld, von Familie und Freunden, keine Seltenheit. Doch im Fall von Alexandra Tzilivaki ist dieser Schritt dennoch sehr besonders. Tzilivaki ist eine exzellente Wissenschaftlerin, die mithilfe von Computermodellen die Funktionsweise von Nervenzellen untersucht. In der frühen Kindheit wurde bei ihr Spinale Muskelatrophie diagnostiziert. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl, kann Hände und Kopf nur eingeschränkt bewegen. Die Erkrankung nimmt die junge Frau als Herausforderung: „Zu verstehen, was sich hinter Begriffen wie „Zellen“, „Neuronen“, „Funktionen“ oder „Proteinen“ verbirgt, hat mich schon immer fasziniert“, erklärt sie. „Solange ich denken kann, hat mich das motiviert, Wissenschaftlerin zu werden und alle möglichen Hindernisse auf diesem Weg zu überwinden.“
Nach der Zusage aus Berlin regelte die damals 24-Jährige alle notwendigen Dinge, kündigte ihre Wohnung, packte ihre Sachen, gab eine Abschiedsparty für Freunde. Doch dann kam alles anders. Alexandra Tzilivaki erhielt einen Anruf aus Berlin: Sie könne leider nicht wie geplant im Oktober nach Berlin kommen, es gebe „kleine Hindernisse.“
Für die Wissenschaft ins Ausland
„Das war ein Schock“, erinnert sich die Forscherin. Denn für sie war klar: Für eine wissenschaftliche Karriere auf Spitzenniveau war es wichtig zu zeigen, dass sie mobil, unabhängig und flexibel war, dass sie an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Arbeitsgruppen gut zusammenarbeiten konnte. „Wissenschaft ist kein Beruf, Wissenschaft ist eine Berufung“, sagt sie. Für ihren Traum war sie bereit zu kämpfen und eine jahrelange Odyssee auf sich zu nehmen. Denn es sollte insgesamt viereinhalb Jahre dauern, bis sie nach Berlin kommen konnte.
Von Beginn an hat auch Linda Faye Tidwell diese Odyssee begleitet. Sie ist am Einstein Center for Neurosciences Berlin und am Exzellenzcluster NeuroCure für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Es gab viele Dinge, die wir organisieren mussten und jeder im Büro hat eine Aufgabe übernommen“, beschreibt sie die Fülle an administrativen Herausforderungen, die auch von den Mitarbeitenden im ECN bewältigt werden mussten, um die Wissenschaftlerin nach Berlin zu holen. „Am Anfang wussten wir gar nicht, wo wir anfangen sollten und woher wir Informationen und Unterstützung erhalten.“
E-Mails, Anträge, Formulare
Es gab keine Blaupause für einen ähnlichen Fall – eine Stipendiatin im Rollstuhl, die auf Hilfe und Betreuung angewiesen ist, aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Wer übernimmt welche Kosten? Welche Institutionen und Versicherungen sind zuständig? Welche Gesetze und Regelungen gelten? All diese Informationen mussten mühsam zusammengesucht werden. Auch eine rollstuhlgerechte, bezahlbare Wohnung in Berlin zu finden, war nahezu unmöglich. 2018 traf Alexandra Tzilivaki ihren Mentor und zukünftigen Betreuer Professor Dietmar Schmitz, Sprecher des Exzellenzclusters NeuroCure an der Charité – Universitätsmedizin. Er sagte: „Alexandra, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen.“ Aufgeben war keine Option.
Schritt für Schritt meisterten Alexandra Tzilivaki und die Teams von ECN und NeuroCure diese Herausforderungen in den kommenden Monaten und Jahren, schrieben unzählige E-Mails, füllten Anträge und Formulare aus und führten Gespräche mit Pflege-, Sozial- und Krankenkassen, mit Ämtern und Behörden. 2018 begann die Neurowissenschaftlerin offiziell ihr Promotionsstipendium an der Charité – allerdings von Griechenland aus und in ihrer alten Arbeitsgruppe an der Universität in Heraklion. Denn bevor sie die für ihre Arbeit notwendige Pflegeassistenz in Deutschland erhalten konnte, musste sie zwei Jahre lang als Arbeitnehmerin in die deutsche Pflegeversicherung einzahlen. Eine scheinbar unüberwindbare Hürde für jemanden, der auf Pflege angewiesen ist, aus dem Ausland kommt und eine Arbeitsstelle in Deutschland antreten möchte. „Das ist in erster Linie kein deutsches, sondern ein europäisches Problem. Es gibt im Jahr 2024 immer noch keine europäische Strategie für die Mobilität von Forscherinnen und Forscher mit einer Beeinträchtigung“, fasst Alexandra Tzilivaki zusammen. „Wir sind die Minderheit in einer Minderheit.“
Endlich Berlin
Die Forscherin hielt durch und konnte schließlich 2021 endlich nach Berlin umziehen und ihre Forschung in der Arbeitsgruppe von Dietmar Schmitz fortsetzen. „Ich erinnere mich daran, wie glücklich ich war, als ich am Flughafen in Berlin ankam“, erzählt sie. In diesem Moment hätten sich die viereinhalb Jahre gelohnt.
Nun kann sie sich voll auf ihre Forschung konzentrieren und detaillierte biophysikalische Modelle einzelner Neuronen und großer neuronaler Netzwerke konstruieren. Mit diesen kann sie die genaue Funktionsweise der inhibitorischen Interneuronen untersuchen. „Das Gehirn ist das vielfältigste Organ unseres Körpers und so vieles ist noch nicht erforscht. Ich hoffe, ich kann mit meiner Arbeit viele neue Erkenntnisse über wichtige Funktionen beitragen“, erklärt sie. Berlin biete dafür den optimalen Rahmen. „Hier im Cluster und ECN gibt es großartige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, es ist eine offene, interdisziplinäre, motivierte und erfolgreiche Gemeinschaft.“ Ihre Promotion wird die Forscherin demnächst abschließen und möchte danach weiterhin in Berlin leben und forschen. Denn hier fühlt sie sich auch abseits der Wissenschaft wohl: „Ich fühle mich sicher und ich fühle mich nicht anders als andere. Diese Stadt hat einen Multi-Kulti-Vibe. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber anderen großen Metropolen.“
Ein ausführliches Interview mit Alexandra Tzilivaki lesen oder als Podcast hören.
„Wenn Frauen Forschungsteams leiten, publizieren diese Teams häufiger zum Thema Geschlechterunterschiede“
Prof. Dr. Gertraud (Turu) Stadler ist Professorin für geschlechtersensible Präventionsforschung an der Charité – Universitätsmedizin und leitet dort die Arbeitseinheit Geschlechterforschung in der Medizin. Im Interview spricht sie über ihre Arbeit als Forscherin und über ihre Ziele in den Feldern Gleichberechtigung, Teilhabe und Chancengleichheit.
Frau Stadler, was verbirgt sich hinter Ihrem Forschungsgebiet „geschlechtersensible Präventionsforschung“?
Die Präventionsforschung ist mein Kernthema, in dem ich untersuche, wie wir möglichst gesund bleiben und chronische Krankheiten vermeiden können. Je früher im Leben wir damit beginnen, gesunde Verhaltensweisen und Umgebungen zu fördern, desto mehr gesunde Lebensjahre gewinnen wir. Mit unserem Forschungsteam sind wir beispielsweise in über 30 Berliner Schulen aktiv und machen geschlechtersensible Rauchprävention mit den Schülerinnen und Schülern. Die Kinder gewinnen bis zu zehn gesunde Lebensjahre, wenn sie rauchfrei bleiben, und unser Programm soll dabei helfen. Jungen, Mädchen und nichtbinäre Kinder sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Und dafür braucht es personalisierte Maßnahmen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Warum sind solche personalisierten Ansätze wichtig?
Beim Gesundheitsverhalten beobachten wir große Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Jungen und Männer finden es teilweise unmännlich, einen Salat oder Gemüse zu essen. Toxische Männlichkeitsbilder wie der coole „Marlboro-Man“ sind noch stark in den Köpfen verankert. Frauen werden viel häufiger mit Depressionen und Angst diagnostiziert, Männer begehen aber dreimal so häufig Suizid. Sie sind auch häufiger übergewichtig und nehmen Vorsorgeuntersuchungen seltener wahr. Männer sterben durchschnittlich fünf Jahre früher als Frauen – und zwar nicht, weil es Schicksal ist, sondern weil es Geschlechterunterschiede im Gesundheitsverhalten und den Lebensbedingungen gibt. Umgekehrt haben Frauen gesundheitliche Nachteile, wenn es etwa um die Behandlung eines Herzinfarkts geht. Die Diagnose und Versorgung sind hier auf den männlichen älteren Durchschnittspatienten ausgerichtet. Frau haben andere Symptome und einen anderen Verlauf. So etwas müssen wir in der medizinischen Forschung und Versorgung besser berücksichtigen.
Wie finden Ihre Ergebnisse den Weg in die medizinische Praxis, um eine geschlechter- und diversitätssensible Versorgung zu etablieren?
Die Forschung dazu steckt in Deutschland und Europa noch in den Kinderschuhen. Es ist eine Querschnittsaufgabe, die nicht nur von einzelnen spezialisierten Einrichtungen und Initiativen erledigt werden kann. Wir brauchen die Beiträge von allen, die zu Gesundheit forschen. Am besten gelingt das, wenn wir Geschlecht und Diversität in allen Studien systematisch berücksichtigen. In Kanada beispielsweise ist das schon Realität. Bei allen öffentlich geförderten Projekten werden die Ergebnisse im Abschlussbericht getrennt nach Geschlechtern aufgeführt. Dann kann man erkennen, wo es Unterschiede gibt – und wo nicht. Wenn wir eine personalisierte Medizin anbieten wollen, brauchen wir bessere Daten. An der Charité untersuchen wir deshalb auch, wie man Diversität eigentlich messen und erfassen kann und entwickeln Methoden, um große Datenmengen gut zu analysieren. Und schließlich arbeiten wir daran, was wir bereits wissen, auch in der Lehre zu verankern. Und zwar über alle Disziplinen hinweg.
Was sollten wir beim Thema Diversität in der Medizin neben dem Geschlecht noch berücksichtigen?
In der Berlin University Alliance haben wir genau zu dieser Frage ganz am Anfang ein gemeinsames Projekt mit über 50 Expert*innen aus dem Berliner und dem internationalen Raum durchgeführt. Der Klassiker ist das Alter, das in der Medizin und Gesundheitsforschung routinemäßig erhoben wird. Aber damit hört es schon auf. Es gibt so viele weitere wichtige Größen: Etwa die soziale Lage, also Bildung, Finanzen, materielle Ressourcen von Personen. Wir wissen, dass die soziale Lage einen sehr großen Einfluss auf Gesundheit hat, aber es gibt kaum systematische Erhebungen. Weiter geht es mit Komorbiditäten – also parallelen psychischen und körperlichen Erkrankungen –, sowie Beeinträchtigungen und Behinderungen, die häufig ebenfalls unzureichend erfasst werden. Sorgearbeit spielt ebenfalls eine Rolle, wenn Frauen zum Beispiel eine Reha nicht aufnehmen, weil sie kleine Kinder oder andere Familienangehörige versorgen wollen. Auch sexuelle Orientierung, Ethnizität, Religion und Weltanschauung sind wichtige Diversitätsdomänen, die bisher wenig berücksichtigt wurden. All das hat Einfluss darauf, wie ich jemanden angemessen medizinisch versorge, ob ein Medikament gut wirkt oder ob wichtige Informationen die Patient*innen erreichen. Am Ende unseres Projekts haben wir einen DiversitätsMinimalItemSatz (DiMIS) erstellt, also einen Vorschlag für einen Minimalfragebogen zu Geschlecht und Diversität, so dass künftige Studien sie systematisch berücksichtigen können.
Sie sind nicht nur Professorin an der Charité, sondern auch Mitglied des wissenschaftlichen Gremiums – des Steering Committees – zum Querschnittsthema Diversität und Geschlechtergleichheit an der BUA. An welchen konkreten Zielen arbeiten Sie in dieser Funktion?
Im Komitee sind Mitglieder aus allen vier BUA-Verbundpartnerinnen. Das sind Forschende aus dem Bereich Diversität und Geschlechterfragen und auch die zentralen Gleichstellungsbeauftragten, die sich sehr gut mit praktischen Maßnahmen auskennen, um Chancengleichheit zu erhöhen. Wir stehen in einem sehr guten produktiven Austausch und bringen im Exzellenzverbund sowohl die Forschung zu diesen Themen als auch die Bedingungen im integrierten Forschungsraum voran, damit alle ihr Talent gut entfalten können. Ein Beispiel dazu: Wenn Frauen Forschungsteams leiten, publizieren diese Teams auch häufiger zum Thema Geschlechterunterschiede. Die Zusammensetzung von Forschungsteams spielt eine Rolle dafür, welche Fragen untersucht werden. Menschen mit Marginalisierungserfahrung haben eine höhere Sensibilität für diese Themen.
Wie weit sind wir in Berlin auf dem Weg zur Chancengleichheit in der Forschung?
In Berlin haben wir seit den 90er Jahren etwa 50 Prozent weibliche Studierende in der Medizin. In der Stadtbevölkerung haben rund 40 Prozent der Menschen eine Migrationsgeschichte. Berlin ist bunt und vielfältig, wir haben sozusagen die ganze Welt bei uns zuhause. Aber die Menschen, die hier vor Ort so wichtige Themen wie „Global Health“ und „Diversity“ direkt verkörpern könnten, sind in den Institutionen noch unterrepräsentiert. Wir wissen aus internationalen Daten, dass wir in der Wissenschaft eine „Leaky Pipeline“ haben, also einen massiven Talentverlust über die Hierarchieebenen hinweg. Talentierte aus unterrepräsentierten Gruppen haben es schwerer, in Führungspositionen zu gelangen.
Welche Talente und welches Potenzial gehen der Wissenschaft damit verloren?
Wir können von den Erfahrungen lernen, die diese Menschen mitbringen. Etwa, wie Gesundheitssysteme in anderen Ländern funktionieren. Ein gutes Beispiel ist Kerala im Süden Indiens. Die Lebenserwartung ist dort ähnlich hoch wie in hochindustrialisierten Ländern, ohne dass dieselben Möglichkeiten der Hochleistungsmedizin zur Verfügung stehen. Unter dem Stichwort „Reverse Innovation“ könnte unser Gesundheitswesen von einigen der dort entwickelten, gut funktionierenden und weniger kapitalintensiven Lösungen profitieren. Auch von Forschenden, die aus Ländern mit hoher Pandemieerfahrung kommen, können wir viel lernen. Die BUA kann wichtige Entwicklungen anstoßen und Impulse geben, um solche Potenziale zu heben. Für die dritte Grand Challenge haben wir beispielsweise eingeführt, dass in den Anträgen für Forschungsgelder ein Denkanstoß enthalten ist zu prüfen, ob Geschlecht und Diversität für die Forschungsfragen eine Rolle spielen. Das wird sonst oft vergessen. Unser Mentoringprogramm für Frauen auf dem Weg zur Professur –ProFil – haben wir um eine englischsprachige Linie erweitert, um eben auch jene zu erreichen und zu fördern, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Exzellente Forschung ist international und wir müssen uns besser dafür rüsten, diese Internationalisierung voranzubringen.
Diversität erforschen
Eine systematische Strategie zur Förderung von Diversität und Diversitätsforschung – das ist eines der wichtigen Ziele der Berlin University Alliance. Der Berliner Exzellenzverbund setzt an vielen Stellen wichtige Impulse, um diesem Ziel näher zu kommen. Unter anderem auch durch die Förderung von vier Nachwuchsforschungsgruppen, die seit 2023 wissenschaftlich untersuchen, wie sich Diversität im Berliner Forschungsraum zeigt, wie sie erfasst wird und wie sie gefördert werden kann.
"Fixing the System: Analyses in the Context of the History of Science"
Forschungsgruppenleiterin: Dr. Sarah Bellows-Blakely, Margherita von Brentano-Zentrum für Geschlechterforschung, Freie Universität Berlin
Die Forschungsgruppe untersucht die Geschichte verschiedener politischer Rahmenbedingungen in Bezug auf Gender und Diversität. Sie analysiert, wie einige Erkenntnistheorien etabliert und politische Vorschläge für Gender, Diversität und verwandte Bereiche institutionalisiert wurden, während dies bei anderen nicht der Fall war.
Die Forschenden wollen verstehen, wie ganzheitliche Erkenntnisse über Diskriminierung sowohl in der Wissenschaft als auch auf Ebenen der nationalen und internationalen Governance marginalisiert wurden. Warum haben sich stattdessen institutionell Konzepte durchgesetzt in denen Geschlecht in einem Vakuum analysiert wird – unabhängig von „Rasse,“ Klasse, Nationalität, Religion, Sexualität und anderen Faktoren? Die Nachwuchsgruppe untersucht diese Probleme anhand von Fallstudien, von denen sich eine mit der Geschichte der Frauenbewegung der Vereinten Nationen und eine andere mit der Geschichte hochschulepolitischer Maßnahmen gegen sexualisierte Belästigung und Gewalt an den Berliner Universitäten befasst. Diese Forschung ist relevant für die laufenden Diskussionen darüber, wie Konzepte in Bezug auf Geschlecht und Vielfalt entstanden sind und wie sie in Zukunft effektiver und gerechter gestaltet werden können.
Mehrfachbarrieren auf dem Weg zu wissenschaftlicher Exzellenz: Empirische Lösungsansätze
Forschungsgruppenleiterin: Prof. Dr. Mirjam Fischer, Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Humboldt-Universität zu Berlin
Menschen mit Behinderungen, Angehörige ethnischer Minderheiten und Frauen* werden gesellschaftlich häufig benachteiligt. Auch in der Wissenschaft sind diese Gruppen unterrepräsentiert und an vielen Prozessen nicht gleichberechtigt beteiligt. Je höher die Karrierestufe, desto größer sind die Ungleichheiten. Um dieses Muster zu durchbrechen, müssen verschiedene Perspektiven als selbstverständlicher Teil der Wissensproduktion an Universitäten einbezogen werden. Die Nachwuchsforschungsgruppe untersucht, wie Angehörige von Minderheiten auf den verschiedenen Hierarchiestufen der BUA-Verbundpartnerinnen vertreten sind und welche Lösungsansätze zu mehr Diversität führen können. Neben den Laufbahnen und der mentalen Gesundheit der Forschenden werden auch ihre Einstellungen zu Diversität, Objektivität und Meritokratie in der Wissenschaft erfasst. Auch Diskriminierungserfahrungen marginalisierter Forschender werden berücksichtigt.
Fix the Institution, not the Excluded!
Forschungsgruppenleiterin: Dr. Aline Oloff, Zentrum für Interdisziplinäre Geschlechter- und Frauenforschung, Technische Universität Berlin
Wie lassen sich Diversitätspolitiken und Antidiskriminierungsarbeit an Universitäten diskriminierungskritisch, kollaborativ und wissensbasiert gestalten? Dieser Frage geht die Nachwuchsforschungsgruppe nach und untersucht, wie Diskriminierungserfahrungen und die Perspektive marginalisierter Gruppen zum Ausgangspunkt für die inklusive und demokratische Entwicklung von Universitäten werden können. Mit einer umfassenden Bestandsaufnahme ermitteln die Forschenden, welche Beratungsstrukturen bei den BUA-Verbundpartnerinnen bereits existieren, wie das dort erlangte Wissen gesichert und genutzt wird und wie daraus effektive Maßnahmen gegen Diskriminierung entstehen können. Nachhaltige Antidiskriminierungsstrukturen und –prozesse an Hochschulen sollen mit forschungsbasierten Konzepten und mit Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure aufgebaut werden.
Entwicklung und Testung einer Intervention zur Verbesserung der Chancengleichheit von unterrepräsentierten Gruppen auf dem Weg zu mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit in Forschung, Lehre und Gesundheitsversorgung der Hochschulmedizin und den Lebenswissenschaften
Forschungsgruppenleiter: Dr. med. Pichit Buspavanich, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité – Universitätsmedizin
Diversität ist nicht nur eine ethische Verpflichtung, sondern besitzt auch wertvolles Potenzial für Wissenschaft und medizinische Forschung. Unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven können zu neuen Erkenntnissen in der Medizin führen und Lösungsansätze für komplexe Probleme liefern. Welche Herausforderungen und Bedürfnisse haben Menschen, die verschiedene Hintergründe und Identitäten haben und marginalisierten Gruppen angehören? In der Nachwuchsforschungsgruppe soll diese Frage untersucht werden, um letztlich bei der Umsetzung diversitätssensibler Interventionen gezielter auf die spezifischen Bedürfnisse und aller Menschen eingehen zu können.