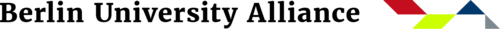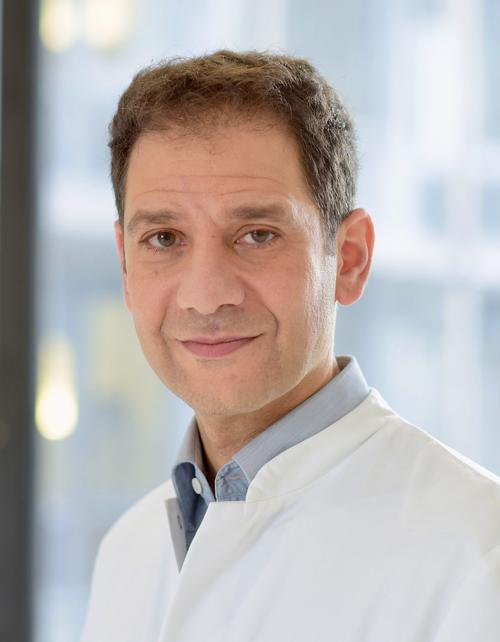Psychologischer Beistand für Eltern in seelischer Not
Bis zu 15 Prozent der Mütter leiden nach der Geburt ihres Babys unter einer postpartalen Depression. Unbehandelt kann sie gravierende Auswirkungen auf das Mutter-Kind-Verhältnis haben. In Berlin finden Elternpaare Hilfe in der Charité, wo eine Eltern-Kind-Station Väter und Mütter in psychischer Not betreut.
Das kollaborative BUA-Projekt „PRODIGY - Practices of Development and International Cooperation with a focus on Global Health Engagement“ widmet sich als ein Leuchtturmprojekt des Berlin Center for Global Engagement (BCGE) diesem Thema. Die Beteiligten arbeiten an einer Wissensaustauschplattform, die Patient*innen und Akteur*innen der Gesundheitsversorgung miteinbezieht. Im Zentrum steht dabei der Austausch mit internationalen Partnern in Jordanien, Vietnam und der Ukraine.
Projektleiter an der Charité ist Malek Bajbouj, Professor für Psychiatrie und Affektive Neurowissenschaft und Leiter der Eltern-Kind-Einheit.
Vielen wissenschaftlichen Laien ist der Begriff „Baby Blues“ geläufig. Ist das mit postpartaler Depression vergleichbar?
Malek Bajbouj: „Baby Blues“ bezeichnet ein auf einen kurzen Zeitraum begrenztes Gefühl der Niedergeschlagenheit, das ungefähr ein Drittel aller jungen Mütter unmittelbar nach der Geburt und in den ersten Wochen danach befällt. Der Grund ist meistens die hormonelle Umstellung nach der Schwangerschaft, die zu Stimmungsschwankungen führen kann. Eine postpartale Depression dagegen hält länger an, setzt oft auch erst zeitverzögert ein, ist gravierender in der Wirkung und deshalb behandlungsbedürftig.
Sind auch Männer von postpartaler Depression betroffen?
Bajbouj: Ja, aber nur halb so oft wie Frauen. Auslöser sind bei ihnen meistens die veränderten Lebensumstände, die mit der Geburt einhergehen. Die Väter sind so oder so, auch wenn sie nicht von Depressionen betroffen sind, ein wichtiger Faktor in der Therapie: als mentale Ressource, aber auch als Stressfaktor für ihre Partnerinnen. Deshalb nennen wir unsere Station bewusst „Eltern-Kind-Station“.
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit den Universitäten und Kliniken in Jordanien, Vietnam und der Ukraine?
Wir sind über internationale Konferenzen und andere Kanäle fachlich miteinander vernetzt. Im Austausch stellten wir fest, dass Angebote für Mütter mit postpartaler Depression in allen vier Ländern dünn gesät sind. Der gesellschaftliche Umgang mit dem Thema ist, kulturell bedingt, jedoch in jedem Land anders. Während, beispielsweise, in Deutschland betroffene Elternpaare häufig aus Sorge vor einer erneuten Depression davon absehen, weitere Kinder zu bekommen, steht in Jordanien eher die Frage im Mittelpunkt, was getan werden kann, damit die Frauen in jedem Fall weitere Kinder bekommen können. In Vietnam wiederum ist der soziale Druck seitens der Gemeinschaft enorm groß. Dort dominiert die Vorstellung, dass eine Mutter das Gesicht verliert, wenn sie zugibt, Hilfe zu benötigen.
Arbeiten Sie an gemeinsamen Standards für Hilfsangebote?
Bei der Qualitätssicherung in der Forschung und der therapeutischen Betreuung ist das unser Ziel. Es geht jedoch nicht darum, in allen Ländern eine ähnliche Ausstattung bei den Hilfsangeboten zu erreichen. Denn während in Deutschland die psychologische Betreuung allgemein fest in der Hand hochspezialisierter, meist akademisch ausgebildeter Expert*innen liegt, betreuen in Vietnam oder in Jordanien häufig auch Pflegekräfte oder Laien Menschen mit psychischen Problemen. Dadurch gibt es viele verschiedene Anlaufstellen.
Wie profitieren die Projektpartner*innen vom Wissen der jeweils anderen?
Die genannten niedrigschwelligen Angebote sind auch für Deutschland interessant. Denn die Kehrseite von spezialisierter Expertise ist, dass das Angebot deutlich begrenzter und der Zugang dadurch schwieriger ist. Darüber hinaus bekommen wir für die Arbeit in unsere Eltern-Kind-Unit durch die Zusammenarbeit wichtiges Wissen über den Umgang mit Familien aus anderen Kulturkreisen. Aus den Partnerkliniken in der Ukraine wiederum haben wir sehr gute Anregungen für die Nutzung von Chatbots in der psychologischen Erstberatung bekommen.
Weitere Informationen
Das Projekt:
PRODIGY wird seit 2023 für insgesamt drei Jahre mit BUA-Mitteln gefördert. Projektsprecher*innen auf BUA-Seite sind: Prof. Dr. Malek Bajbouj (Charité – Universitätsmedizin Berlin), Prof. Daniel Strech (Berlin Institute of Health), Prof. Michael Zürn (Freie Universität) und Prof. Isabel Dziobek (Humboldt-Universität). Universitäre Partner in Vietnam und Jordanien sind das Jordan University Hospital in Amman und die Hanoi Medical University.
Malek Bajbouj ist Direktor für Internationale Angelegenheiten der Charité und Geschäftsführender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.